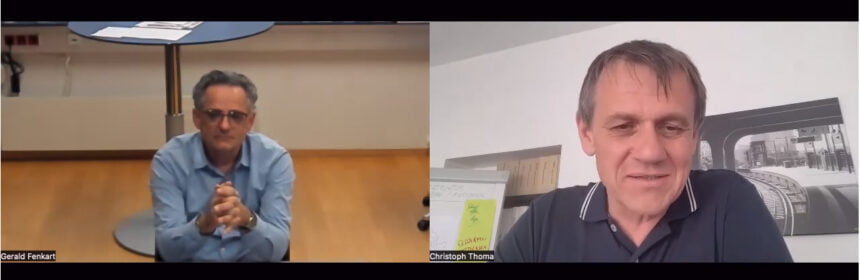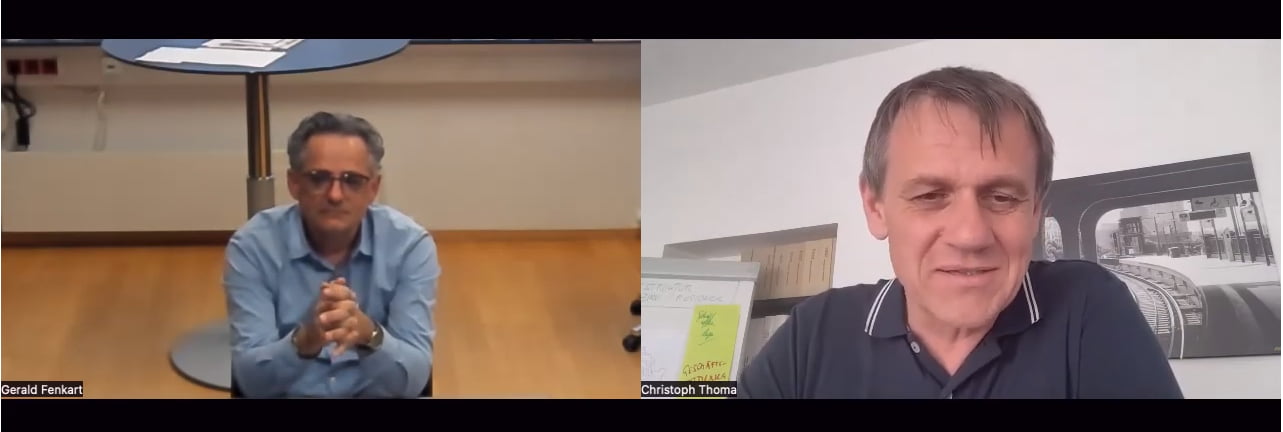Wahlfreiheit ist notwendig!

Wahlfreiheit ist notwendig
Die Abschaffung der Sonderschulen wäre ein Verstoß gegen die Behindertenrechtskonvention. Diese verlangt im Artikel 24 „das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung“ und weiters „Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen“. Es soll sichergestellt werden, dass „Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern“ und „angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden“. Nirgends steht, dass sich ein Staat verpflichtet, Sonderschulen abzuschaffen.
Wenn mit der Formulierung „gewährleisten die Vertragsstaaten ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen“ eine undifferenzierte Gesamtschule und ausschließlich inklusiver Unterricht gerechtfertigt werden soll, beruht dies auf einem Missverständnis. Nicht die einzelnen Bildungseinrichtungen müssen inklusiv geführt werden, sondern das Bildungssystem als Ganzes muss und soll inklusiv sein.
Nur die Wahlfreiheit garantiert, dass bestmöglich Sorge getragen werden kann, „Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen“, wie es in der Konvention steht.
Gastkommentar von unserem Vorstandsmitglied Mag. Ronald Zecha in der Tiroler Tageszeitung vom 27.10.2023